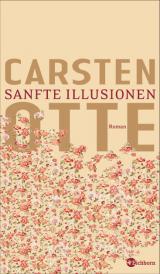Mädchenauge
Tamara öffnete die Schublade der aufwendig verzierten Jugendstil-Kasse, und obwohl sie genau wußte, daß sie an diesem Vormittag noch keine einzige Blume verkauft hatte, zählte sie das Wechselgeld. Sie sah den grauen Brief vom Finanzamt, der in dem leeren Fach für die großen Scheine lag, überlegte eine Weile, ob sie den Umschlag öffnen sollte, entschied sich dagegen und schloß die Kassenlade wieder. Ich bin müde, dachte sie, viel zu müde für schlechte Nachrichten. Sie ging durch den Verkaufsraum und sprach mit sich selbst. Nein, sie durfte sich nicht verrückt machen lassen. Sie mußte es schaffen. Irgendwie. Sie hatte den Laden erst vor einem Jahr übernommen. Es wäre zu peinlich, wenn sie jetzt schon aufgäbe.
Sie nahm den Eimer mit den gelben Tulpen zur Hand und erschrak. Sie hatte die Ware an diesem Tag schon zweimal überprüft. Sie schaute auf die Straße. Ein Bus fuhr vorbei. Passanten hatten es eilig. »Stehenbleiben«, murmelte sie und griff in die frischen Tulpenblätter. Sie rieb die Stengel aneinander, bis sie ein sanftes Quietschgeräusch hörte, strich mit der Hand über die Gänsehaut ihres Oberarms und sah die Gartenschere, die neben dem Tulpeneimer lag. Sie zögerte noch, schnitt dann aber doch einen Blütenkelch ab, betrachtete den kahlen Stiel, kürzte ihn, einmal, zweimal, so daß der Rest im Blumenwasser verschwand. Der gelbe Tulpenkopf lag auf dem Boden, und am liebsten hätte sie ihn dort auch liegen gelassen. Wozu das alles? fragte sie sich, bückte sich trotzdem und warf die Blüte quer durch den Laden in die Aluminiumwanne für den Biomüll. Sie drehte sich um, stand vor der Vase mit den Lilien und dachte an den Mann, der hin und wieder vorbeikam, um einen Strauß weißer Lilien zu kaufen. Er wirkte sehr verlegen, wenn er sich für die Lilien entschied. Sie zeigte ihm einen Topf mit Frühjahrsblühern. Und er lächelte. Sie ging zu den roten Gerbera, und er sagte, daß er sich unter anderen Umständen bestimmt für einen dieser Vorschläge hätte erwärmen können. Er redete nicht viel. Vielleicht war er schüchtern. Vielleicht war er verheiratet. Der Lilienmann, der immer feine Anzüge trug, wenn er bei ihr auftauchte, hielt sich in diesem Punkt äußerst bedeckt. Er deutete lediglich an, daß das unbekannte Wesen, das er so regelmäßig mit weißen Lilien beschenkte, Überraschungen nicht mochte. Überraschungen? Die gab es ohnehin sehr selten.
Wenn ein Kurgast etwas Ausgefallenes für eine Dame im mittleren Alter wünschte und sie ihm Strelitzien oder Anthurien ans Herz legte, ging der Mann bald zum Kübel mit den roten Rosen der Sorte Duftzauber 84. Wenn eine Dame den Laden betrat, die, wie sie schon bald berichtete, neulich erst nach Baden-Baden gezogen war, weil sie einen der begehrten Plätze im Altenstift Schwarzwaldblick bekommen hatte, konnte Tamara meist schon an der Kleidung ablesen, welche Blumen die Kundin auswählen würde. Trug die Frau weiß, dann nahm sie wahrscheinlich Nelken; trat sie im rosa Kostüm auf, entschied sie sich je nach Jahreszeit für Stiefmütterchen oder Alpenveilchen.
Beim Lilienmann hatte sie sich allerdings geirrt. Sie hatte ihm etwas Buntes zugetraut. Leuchtende Ranunkeln vielleicht. Gelbe, rote, violette Freesien. Aber nicht diese weißen Blumen, die nach Friedhof aussahen. Beim Lilienmann war sie sich, was die Blumen betraf, ganz besonders sicher gewesen, und so hatte sie sich sehr darüber gefreut, daß ihre Vermutungen nicht zutrafen und dieser Unbekannte nicht so leicht auszurechnen war. Sie hatte angenommen, er sei in Baden-Baden nur zu Besuch und werde ihn nicht wiedersehen. Als der Lilienmann aber kurze Zeit später noch einmal aufgetaucht war und erneut weiße Lilien bestellt hatte, als der Lilienmann bald regelmäßig kam und ihr nichts mehr einfiel, was sie ihm sonst noch empfehlen konnte, wußte sie, daß er zur Kurstadt gehörte wie der Rosenkavalier und die Veilchendame.
Seit Tagen ließen sich diese Stammkunden nicht mehr blicken. Draußen im Park blühten die Krokusse, der noch hellgrüne Rasen war mit viel zu vielen Blumen übersät. Bellis, rot und weiß. Primeln. Märzbecher. Ein paar späte Schneeglöckchen gab es noch, und die Narzissen kündigten sich an. Wer stellte sich Blumen in die Wohnung, wenn es vor der Tür aussah wie zur Bundesgartenschau? Aus der Ferne hörte sie das Läuten der Glocken. Es war zwölf Uhr. Sie ging ins Lager und kam gleich wieder zurück. Sie drehte eine weitere Runde durch den Verkaufsraum. Und noch eine. Das war die wievielte? Sie konnte nicht mehr stehen. In ihren Beinen kribbelte es unangenehm. So ein Geschäft konnte ein Gefängnis sein. Sie nahm ein weißes Blatt Papier und schrieb darauf: Bin gleich wieder da! Jetzt war Mittagspause. Die nahm sie zwar so gut wie nie, aber sie sehnte sich an diesem Tag, der so schlecht begonnen hatte, nach der milden Frühlingsluft. Sie wollte hinaus, endlich wieder durch den Ort ziehen, dessen Schönheit sie nur nach Feierabend und am Wochenende genießen konnte. Wenn überhaupt. So erschöpft war sie am Abend und an den freien Tagen, daß sie diese Zeit am liebsten vor dem Fernseher verbrachte. Obwohl sie kaum etwas getan hatte, war sie erschöpft. Oder gerade weil sie kaum etwas getan hatte. Jetzt aber los, sagte sie sich, und sie hätte beinahe vergessen, die Tür abzuschließen, denn sie war einfach losgerannt, hinaus in den Kurpark, zu den Krokusfeldern, die von Jahr zu Jahr größer wurden, vor denen die Leute andächtig stehen blieben wie diese Frau, die ihre Juwelen ausführte. Hals und Handgelenke waren mit Edelsteinen geschmückt. Aber vor dem zarten Schimmern der hellblauen Krokusse verblaßten die Klunker. Tamara atmete tief ein, und es kam ihr vor, als könnte sie fliegen, wenn sie nur weiter Luft holte.
Sie erinnerte sich daran, daß man das Tal mit einem Heißluftballon erkunden konnte. Vielleicht sollte sie Rolf zu einem Rundflug einladen. Vielleicht würde er aus der Vogelperspektive begreifen, was sie an dieser Stadt faszinierte: Wie hier alles zusammenpaßte, die Spaziergänger und der Park, die alten Villen und die ebenso alten Bäume, die Abgeschiedenheit mancher Schwarzwaldwege und die Flaniermeile am Oosbach. Rolf hatte mal gesagt, er wolle nicht in einer Postkartenidylle leben. Wieso eigentlich nicht?
Baden-Baden erinnerte sie an Italien. Die Häuser, an denen sie vorbeiging, hätten auch in der Lombardei stehen können. Das Eis im Café Capri war mindestens so gut wie in Florenz. Und der warme Wind, der von der Rheinebene hochwehte, fühlte sich an wie in der Toscana.
Es war die richtige Entscheidung, den Blumenladen der Eltern zu übernehmen, auch wenn es bessere Jobs gab, als im Blumenparadies Baden-Baden ausgerechnet Blumen zu verkaufen. Sie dachte daran, wie frustriert sie sich noch vor einer halben Stunde gefühlt hatte, und sie nahm sich vor, künftig häufiger in den Park zu gehen. Diese Postkartenidylle tat gut, sie ging beschwingt zurück, und kaum stand sie hinter der Kasse, klingelte das Türglöckchen.
Auf Isabelle Varnhagen war Verlaß. Sie bestellte zu allen Jahreszeiten asiatische Züchtungen. Sie legte viel Wert auf Exklusivität, und es war nicht leicht, ihren Wünschen immer nachzukommen. »Wie geht´s dir?« fragte Isabelle, und Tamaras Blick fiel auf eine goldene Rolex. Mit dieser einen Uhr könnte sie ihre Mietrückstände begleichen und mit den anderen zwanzig Rolexuhren, die Isabelle besaß, die Bankschulden bezahlen. Und noch viel mehr. Tamara dachte an ihre eigene kleine Uhrensammlung. Auf Flohmärkten hatte sie ein paar Modelle zusammengetragen. Uhren, die alt und schön waren. Mit Uhrwerken, die meist zu schnell oder zu langsam liefen. Jeden Abend drehte sie an den Schräubchen, korrigierte Zeit und Datum. Ob Handaufzug oder Automatik, ob Batterie oder Solarzelle, in ihrem Haushalt waren allen Uhren in Betrieb.
»Gut, gut. Aber wenn im Laden mehr los wäre, ging´s mir noch besser«, antwortete Tamara. Isabelle steckte sich einen Zigarillo an, und bald schon überlagerte der süßliche Tabakrauch die Blumendüfte. Tamara erwog ein Rauchverbot in ihrem Laden, verwarf die Idee aber sofort. Sie würde es sowieso nicht durchsetzen. Isabelle war ja abhängig von den Zigarillos. Tamara öffnete die Tür, damit frische Luft in den Laden kam. »Das wird schon«, sagte Isabelle und zeigte auf die Glasvase mit den Ingwerblüten. »Pack mir von denen bitte zwanzig Stück ein.«
Benjamin schlenderte durch die Fußgängerzone und sah die lange Schlange vor dem Café Hösterkamm. Ab achtzehn Uhr wurden dort die Backwaren zum halben Preis angeboten. Die Leute waren bestimmt nicht darauf angewiesen, verbilligtes Brot zu kaufen. Dafür sahen sie zu gediegen aus. Den Herrn mit Hut und vollem Backenbart kannte er, sein Nachbar Isenweg: ein Mann, der immer im schwarzen Anzug auftrat und wahrscheinlich sparsam war wie kein anderer im Ort. Er war Finanzberater. Isenweg betrieb auch ein Inkasso-Unternehmen. Wahrscheinlich für diejenigen, die sich von ihm nicht lange genug oder schon viel zu lange hatten beraten lassen.
Isenweg versorgte sich, wie er oft erzählt hatte, in der Happy hour nicht nur mit einem Vollkornbrot fürs Abendessen, er nahm auch die Brötchen für den nächsten Morgen mit, die er in seinem Spezialtoaster kurz aufwärmte: »Schmeckt besser als eine frische Schrippe.« Isenweg kam aus Berlin; angeblich hatte ihn seine Sekretärin vor vielen Jahren nach Baden-Baden gelockt.
Isenweg grüßte. »Nutzen Sie auch die günstige Gelegenheit?«. Benjamin sagte, er habe noch genug Brot. Sich in die Hösterkamm-Schlange einreihen? Niemals. Eine Frau, die als Angestellte des Cafés zu erkennen war, weil sie die gelb-violette Hösterkamm-Schürze trug, gab ein Handzeichen, und die Schlange, an deren Spitze sein Nachbar das Tempo vorgab, begab sich ins Café. Benjamin beobachtete die Szene, die sich vor der Bäckerei-Theke abspielte. Als Isenweg auf die übriggebliebenen Brötchen zeigte, die er mitzunehmen wünschte, bekamen die anderen Leute lange Hälse. Und die Gesichter erzählten, was die Langhälse dachten: So viel nimmt der Mann! Wann soll er das alles essen? Der hat doch keine Kinder! Kein Wunder, daß er so dick geworden ist ...
Benjamin machte sich davon, er mußte sich beeilen, um rechtzeitig im Blumenladen vorbeizuschauen. Schon am Morgen, als er aufgestanden war, hatte er sich überlegt, um welche Uhrzeit er Tamara besuchen sollte. Er dachte an das Abendessen im Parkhotel und die Telefonbuch-Recherche. Die Frau hieß tatsächlich wie die Heldin in Arnds Groschenheften. Ohne Zufälle keine Liebesgeschichten. Vielleicht sollte er doch mal lesen, was Arnd schrieb.
Er wollte mit ihr möglichst allein sein. Die Stunde vor Ladenschluß war ideal. Die Sehnsucht, die ihn antrieb, kam ihm unheimlich vor. Beim letzten Mal hatten sie sich ziemlich lange in die Augen geschaut, und seitdem fühlte er sich sehr alt und sehr jung zugleich. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wann er zum letzten Mal solche Blicke getauscht hatte. Am liebsten wäre er den Rest des Weges gerannt, aber keuchend wollte er bei ihr nicht auftauchen. So ging er schnell, ohne zu rennen, also fast wie ein Wettkampfgeher mit wackelndem Hintern, vorbei an den vielen Shops, in denen T-Shirts, Kaffeetassen und Putzlappen nur einen Euro kosteten. Vorbei an Schaufenstern, auf denen Räumungsverkauf und Geschäftsaufgabe geschrieben stand. Die Hinweisschilder waren ausgebleicht; der Räumungsverkauf und die Geschäftsaufgabe hatten vor Monaten stattgefunden.
Er fühlte ein leichtes Magendrücken: Die herrschaftlichen Jugendstilhäuser waren doch nicht gebaut worden, damit die Läden im Erdgeschoß leerstanden oder von Billigketten besetzt wurden. Von Karlsruhe, von all den anderen Orten in der Region kannte er dieses Phänomen. Baden-Baden war lange Zeit verschont geblieben, aber nun sah die berühmte Lange Straße genauso aus wie die Fußgängerzone in jeder anderen deutschen Kleinstadt.
Benjamin schaute nach rechts und links, aber nicht geradeaus, und so stieß er gegen einen Mann, der ihn sofort erkannte. »Entschuldigen Sie, Herr Rust. Da habe iiiich wohl ein wenig gegegeträumt.« Es war Niemeyer, der es wieder eilig hatte. Der Kellner zog weiter, betrat einen Laden, der zur McGeiz-Kette gehörte, und als Benjamin überlegte, was ein Parkhotelkellner, der die Schönheit und Eleganz seines Arbeitsplatzes sicherlich zu schätzen wußte, in der Resterampe zu suchen hatte, trat Arnd aus dem Geschäft heraus. Der Arme war nun auch auf diese Billigläden angewiesen. So viel Geld konnte er mit seinen Groschenromanen nicht verdient haben. Ob er schon Sozialhilfe bezog? Benjamin suchte eine Tür, durch die er verschwinden konnte, und so huschte er in die Parfümerie Claasen.
Familie Claasen führte die Parfümerie in der dritten Generation, und der Gedanke an diese Duftwassertradition tröstete ihn, obwohl er Parfümerien nicht leiden konnte. Als sich eine Verkäuferin näherte, fiel ihm ein, daß er einen Deoroller brauchte. Er nahm sich vor, das Geschäft zu verlassen, wenn eine allzu freundliche Verkäuferin ihm etwas anderes aufzuschwatzen versuchte. Als er in dem Raum stand, dessen Größe ihn jedes Mal beeindruckte, als er die florale Deckenmalerei und die alten Flakons in den Regalen sah, als die typische Duftwolke ihn umgab und eine Frau mit hochgesteckten, dunkelbraunen Haaren und rot angemalten Lippen einen guten Tag wünschte, konnte er sich an den Markennamen des Deos, das er seit Jahren benutzte, nicht mehr erinnern. Die Verkäuferin allerdings, deren persönliche Duftnote so intensiv war, daß sich ihr Parfum gegen das allgemeine Geruchsgemisch durchsetzte, wußte Bescheid. »Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie immer Caractère genommen.« Benjamin blickte auf ihre weiß lackierten Fingernägel, dann auf die silbrig schimmernden Augenlider. Die Frau hatte recht.
Im Hintergrund hörte er eine Arie, die er Berlioz zuordnete. Benjamin meinte, die Oper Béatrice et Bénédict zu erkennen. Er fragte sich, ob in der Parfümerie Claasen grundsätzlich nur Werke von Komponisten, die in Baden-Baden gelebt hatten, als Hintergrundmusik verwendet würden. Als die Verkäuferin sagte, die* rauchig-herbe Duftnote *seines Deodorants passe sehr gut zu ihm, und sich erkundigte, ob er auch mal ein neues Eau de toilette ausprobieren wolle, konnte er nicht ablehnen. Die Gerüche, Berlioz und der Charme der Verkäuferin lähmten ihn. Erst als die Frau mit einer Creme aus der berühmten Kosmetikfirma Varnhagen ankam, erwachte sein Widerstand, und er wies das Angebot zurück, was die Verkäuferin, die er sich ohne Schminke schlecht vorstellen konnte, nicht abhielt, besonders hautverträgliche Duschlotionen aus Frankreich auf den Tisch zu stellen. Während er an dieser und jener roch und schon bald keinen Unterschied mehr wahrnahm, bemerkte er einen Mann in Uniform, der durch den Laden marschierte, die anwesenden Kunden, meist Frauen um die siebzig, streng musterte und sich schließlich zum Ausgang begab. Das war Kolja. Er hatte früher beim Varnhagen als Wachmann und zuletzt als Platzwart im Tennisclub gearbeitet. Und jetzt?
»Sie müssen verstehen«, sagte die Verkäuferin, »die Diebstähle haben drastisch zugenommen. Wir haben große Verluste. Wir bedauern zutiefst, aber auf Sicherheitspersonal können wir nicht länger verzichten.«
»Diebstähle in Baden-Baden?«
»Es hat sich viel verändert in unserer Stadt.«
»Na, bei diesem Wachmann wird das bestimmt nicht mehr passieren«, sagte er.
Benjamin suchte den Blickkontakt zu Kolja.
»Sie kennen Herrn Barokin?« fragte die Verkäuferin.
»Ja, bisher hat er über die Schuhe im Tennisclub gewacht.«
Bevor Benjamin loslachen konnte, stand Kolja vor ihm.
»Wie dir gehen?«
»Gut. Und wie gehen meine Schuhe?« fragte Benjamin. Kolja grinste. »Auch gut.« Die Schuhe hatte Kolja in der Umkleidekabine des Clubs gefunden, in seinen Besitz überführt und sie unvernünftigerweise auch auf der Tennisanlage getragen. Benjamin hatte ihn damals zur Rede gestellt, worauf der sonst sanfte Mann laut geworden war und Prügel angedroht hatte. Sie waren schließlich ohne Handgreiflichkeiten übereingekommen, daß Kolja die Schuhe behalten dürfe, wenn er ein paar Euro für einen guten Zweck spendete, und weil Benjamin ihn nicht an den Präsidenten verpfiffen hatte, der ihn bestimmt sofort entlassen hätte, sagte Kolja nun immer, wenn sie sich trafen: »Du guter Deutscher.«
»Warum bist du denn nicht mehr im Tennisclub?«, fragte Benjamin.
»Zu wenig Geld«, sagte Kolja. »Drei Euro pro Stunde, Sklavenarbeit.«
»Verstehe. Und was machst du, wenn du hier jemand beim Klauen erwischst?«
»Böse gucken. Reicht schon. Habe ich gelernt von dir.«
Benjamin zahlte und wunderte sich, wie teuer der Deoroller war. Den letzten mußte er vor der Euroumstellung gekauft haben. In der edlen Papiertüte sah Benjamin die ihm bekannte Verpackung des Deos und einen mit Cellophanpapier geschützten Pappquader. Das neue Eau de toilette. Das hatte er schon wieder vergessen. Der Euro war also nicht schuld am hohen Preis. Die Parfumverkäuferin hatte ihren Job gut gemacht, und er hatte sich verführen lassen. Ihm kam die Blumenhändlerin in den Sinn, die es, was ihre Beratungskünste betraf, bislang nicht so weit gebracht hatte. Dabei hörte er ihr genau zu, wenn sie mit einfachen Worten eine Kamelienblüte beschrieb, wenn sie erklärte, warum Iris und Kalla so gut zusammenpaßten. Erst wenn ihr nichts mehr einzufallen schien, bedankte er sich und nahm doch wieder die weißen Lilien. Dabei waren ihm die Lilien gleichgültig. Gerne hätte er auch etwas anderes genommen, obwohl die Art und Weise, wie die Blumenhändlerin auf seine vermeintliche Lilienmanie reagierte, ihn anrührte. Einmal, als er ihre Vorschläge erneut dankend ablehnte, war sie sogar ein wenig zusammengesackt. Da war ihm klar geworden, was er an ihr bewunderte: daß sie kein Theater spielte und Blumen verkaufte, weil sie davon überzeugt war.
»Viel Freude mit dem neuen Duft wünsche ich Ihnen.«, unterbrach die Parfumfrau seine Gedanken. Er hatte sich für Egoïste entschieden. Das wird Wiebke gefallen, dachte er. Da wird sie sich bestätigt fühlen.
»Vielen Dank.«
»Wir haben zu danken«, erwiderte sie.
»Du wieder kommen«, ergänzte Kolja.
»Wenn mein Deo aufgebraucht ist, schaue ich bestimmt vorbei.«
»Du guter Deutscher«, sagte Kolja. Der Mann war im Krieg gewesen. Irgendwo in Jugoslawien. Wenn Kolja betrunken war, beschimpfte er die Deutschen als Kriegsverbrecher. Aber was hieß das schon? Ich will, dachte Benjamin, gar nicht wissen, was ich sage, wenn ich zwei, drei Biere getrunken habe. Oder eine Flasche Wein. Oder ...
Die duftende Verkäuferin schaute zu Kolja. Ihr schien die Uniform zu gefallen.
»Ich muß noch Blumen besorgen«, sagte er, um sich endgültig zu verabschieden.
»Wo gehen Sie denn hin?« fragte die Parfumverkäuferin.
»Zum Mädchenauge, so heißt der Laden, wenn ich mich nicht irre.«
»Das Geschäft gehört einer alten Schulfreundin. Grüßen Sie Tamara von mir.«
»Und wie heißen Sie?«
»Ilka, da weiß sie Bescheid.«
»Werde ich machen«, sagte er. Die Frau war so stark geschminkt, daß im Gesicht keine Pore, kein Leberfleck und kein rotes Äderchen zu sehen war. Pickel sowieso nicht.
Tamara versprach Isabelle, die Ingwerblüten noch am Abend vorbeizubringen, als Rolf in den Laden stürzte. Sein Cordsakko kann er auch mal reinigen lassen, dachte Tamara, als sie bemerkte, wie stark er nach Schweiß roch. »Ich muß mit dir reden!« sagte er aufgeregt. Isabelle schien er übersehen zu haben. Als Tamara ihm klarzumachen versuchte, daß es bessere Gelegenheiten gab, um Grundsatzdiskussionen anzufangen - denn darauf würde dieses Ich muß mit dir reden bestimmt wieder hinauslaufen -, als sie ihn bat, später noch einmal vorbeizukommen, wurde seine Stimme lauter. Daß es ihm sehr wichtig sei, herrschte er sie an, daß er mit ihr jetzt und sofort sprechen wolle. »Ich habe Kundschaft, und das ist auch sehr wichtig.« Dafür schien er kein Verständnis zu haben, denn statt mal etwas Nettes zu sagen, brüllte er: »Diesen Muff ertrage ich nicht mehr.« Das war typisch Rolf. Muffig war in seiner Welt so gut wie alles, was ihm nicht paßte. Früher hatte sie sich über seine Tiraden amüsieren können. Doch jetzt ging er ihr nur noch auf die Nerven. »Da kann ich dir auch nicht helfen«, sagte sie und hoffte, daß dieses Gespräch damit beendet war. Isabelle schüttelte den Kopf, und Rolf schwieg eine Weile.
Tamara ging auf ihn zu. Sie legte einen Arm um seine Schulter, obwohl sie das eigentlich nicht tun wollte. Um des lieben Friedens willen, sagte sie sich und versuchte zu lächeln. Rolf stieß sie zurück und schrie: Er habe eine Entscheidung getroffen, er werde Baden-Baden endgültig verlassen, der Möbelwagen sei bestellt. Wenn er länger bliebe, würde er bestimmt eine Kurstadtallergie entwickeln und schließlich an einem Baden-Baden-Asthma krepieren. »Ich hasse diese grüne Hölle.« Isabelle kicherte nun. Es war irre, was Rolf sagte. Ein cholerischer Anfall. Und leider nicht das erste Mal. Neulich erst hatte er ihren Blumenladen einen Kleinmädchentraum genannt. Daß sie Schulden gemacht hatte, um diesen Traum zu verschönern, hielt er für total hirnrissig. Er mochte weder die neue Spiegelwand noch die italienischen Glasvasen, und den Namen ihrer Blumenhandlung konnte er sowieso nicht ausstehen. Mädchenauge, das klang doch nach Puff, hatte er gemeckert, und als sie ihm in einem Pflanzenbuch die hellgelben Zungenblüten der Coreopsis lanceolata gezeigt und von einem Blumenauge geschwärmt hatte, das dem Volksmund zum Trotz weniger nach Mädchen als nach Tiger aussah, hatte er sie ausgelacht und ihr geraten, zum Augenarzt zu gehen. Und zum Psychologen. Er hatte sie schon oft in Behandlung schicken wollen. Sie habe nur den Blumenladen im Kopf, schrie er nun wieder, das sei doch nicht normal. »Halt endlich die Klappe!« gab sie zurück. »Und wenn du es nicht kannst, hau ab!« Das hätte sie ihm schon viel früher sagen sollen. Die letzten Male war sie, wenn er ausrastete, viel zu verständnisvoll gewesen. Isabelle nickte zustimmend.
»Okay«, nuschelte Rolf und schaute zu Boden. Es klang, als habe er aufgegeben. Als wolle er nicht länger streiten, als wolle er überhaupt nie mehr mit ihr streiten, als sei alles vorbei. Tamara spürte ihre Erleichertung. Kein bißchen traurig war sie, nur erleichtert. So lange waren sie gar nicht zusammen, aber nun gab es keinen anderen Ausweg. Nein, Rolf paßte nicht zu ihr, er gehörte woandershin. Wenn er von seinen Reisen zurückkam, freute er sich nicht, sie wiederzusehen, sondern sprach davon, Baden-Baden so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Er war, wie er oft betont hatte, nur in die Kurstadt gezogen, weil er anderswo keine Stelle bekommen hatte. Für ihn war Baden-Baden ein Abstellgleis. Sie hatte sich an das, was er den großspurigen Provinzmuff nannte, längst wieder gewöhnt. Rolf konnte sich mit den Gegebenheiten nicht arrangieren. Ihn machte die Ruhe des Kurortes unruhig. Er konnte über die geschwungenen Wege und weichen Rundungen der Schwarzwaldhügel lästern, als gehe von ihnen eine ernste Gefahr für seine Psyche aus. Er wollte Ecken und Kanten, Dreck und Getöse. Tatsächlich wäre sie nur ungern in die, wie sie zigmal gesagt hatte, gräßliche Beamtenstadt Karlsruhe umgezogen. Das war einer seiner Vorschläge gewesen, dort eine Wohnung zu suchen und jeden Morgen nach Baden-Baden zur Arbeit zu fahren. Das hatte sie zu verhindern gewußt, und vielleicht war ihre Weigerung auch ein Grund dafür, daß Rolf nun durchdrehte. Sie hatte sich in dieser Frage durchgesetzt, und er war es nicht gewohnt, klein beizugeben. Vielleicht lag es aber auch an seinem Job: Wenn ihn, wie er sagte, die Vision einer Ausstellung umtrieb, dann wollte er sie auch umsetzen, und die Vorstellung, in Baden-Baden zu wohnen, war für ihn die absolute Antivision. Diese Stadt paßte nicht zu seinem Lebenskonzept, zu dem ein vielseitiges Kinoprogramm, halbwegs heruntergekommene Kneipen und eine Bevölkerung gehörten, deren Mehrheit das Rentenalter noch nicht überschritten hatte. Rolf, der Blödmann, war nicht kompromißbereit, und jetzt stand er vor ihr und machte sich endgültig zum Narren. Denn anstatt nach seinem kleinlauten Okay abzuhauen, schrie er wieder, biß sich auf die Unterlippe, die zu bluten begann. Seine Finger zitterten, als leide er unter Parkinson. Wie abstoßend, dachte sie und konnte sich nicht mehr vorstellen, mit diesem zappelnden Mann jemals im Bett gewesen zu sein. Diese hageren Zitterfinger hatten sie schon gestreichelt? Wie ekelhaft kamen ihr jetzt seine ungewaschenen grauen Zottelhaare vor, die er wieder mal - was ihm natürlich gefiel, was aber besonders unsexy aussah - mit einem roten Gummiband zu einem Zopf zusammengebunden hatte.
Rolf baute sich vor Isabelle auf: »Ihr Mann wird sich einen anderen Deppen suchen müssen!« Rolf beschwerte sich, wie beschissen es doch sei, dafür zu sorgen, daß die beschissene Sammlung Varnhagen in aller Welt ausgestellt werde. Er sah aus, als werde ihm übel, wenn er den Namen Varnhagen in den Mund nahm. Er war außer sich. »Würdest du bitte meinen Laden verlassen«, rief Tamara, zeigte zum Ausgang und sah, daß der Lilienmann vor der Glastür stand. Er hatte Rolfs Schreierei wohl schon eine Weile mitbekommen. So verstört sah er aus. Tamara bat ihn mit einer energischen Handbewegung hereinzukommen.
Rolf verließ den Laden, rempelte den Lilienmann an und sagte: »Schichtwechsel!« Der Lilienmann schaute Rolf etwas verwundert hinterher und schüttelte den Kopf. »Hallohallo«, rief Isabelle dem Lilienmann zu, als seien sie beste Freunde. Ihre aufdringliche Begrüßung schien ihn allerdings wieder zu vertreiben. Er sei, sagte er, nur zufällig vorbeigekommen, wollte eigentlich gar keine Blumen kaufen. »Dann bis zum nächsten Mal«, sagte Tamara verärgert und ging zur Kasse zurück.
»Alles in Ordnung?« fragte Isabelle.
»Ja, ja.«
»Dieser Rolf ist aber auch ...«
»Das macht zweihundertdreißig Euro«, fuhr Tamara dazwischen. Isabelle zog die Augenbrauen hoch. Das tat sie immer, wenn ihr etwas nicht paßte. Sie suchte in ihrer Handtasche nach dem Geldbeutel.
»Kennst du unseren Philosophenclub?«, fragte Isabelle. »Nein? Zum nächsten Vortrag müssen wir unbedingt hingehen. Damit du mal auf andere Gedanken kommst.«
Tamara schmunzelte. Daß Isabelle sich philosophische Vorträge anhörte, hätte sie nicht vermutet. Isabelle legte zweihundertfünfzig Euro auf den Tisch, und Tamara fragte, ob sie ihr, sozusagen als Ersatz für Rolf, einen Kurstadtphilosophen andrehen wolle.
»Na, besser einen Philosophen als einen Spinner«, antwortete Isabelle.
»Wo liegt denn der Unterschied?« Tamara gab ihr das Wechselgeld.
»Nein, nein, das stimmt schon.«
Erst nahm Tamara an, Isabelle sei ihrer Meinung, begriff dann aber, daß sie ein großzügiges Trinkgeld bekommen hatte. Sie legte die beiden Zehner in die Kasse und blickte auf den Brief vom Finanzamt, der nicht verschwinden wollte. Isabelle zog einen kleinen Spiegel aus ihrer Handtasche, trug Puder auf und lachte. Sie sah traurig aus, was auch an den Tränensäcken lag, die sich nicht wegschminken ließen.
»Komm doch mit!« sagte Isabelle.
»Wieso eigentlich?«
»Zu zweit ist es lustiger. Außerdem bin ich deine beste Kundin.«
»Da kann ich ja schlecht nein sagen.«
»Stimmt, kannst du nicht. Und jetzt schau nicht so empört.«
Tage vergingen, ohne daß sich die Kasse füllte. An einem Mittwoch kam niemand. Ihre Angst vor der Pleite wuchs, und auch ein Spaziergang im Park vermochte sie nicht abzulenken. Am Abend war sie so betrübt, daß sie sogar vergaß, ihre alten Uhren aufzuziehen. Das war ihr zum letzten Mal passiert, nachdem sich Mario nach Mailand verabschiedet hatte. Mario war auch ein Spinner ... im Gegensatz zu Rolf konnte er aber immerhin Pizza backen ... war das ein schöner Sommer mit ihm ... damals in den Semesterferien ... sie schrieb keine einzige Hausarbeit ...
Irgendwann kam Isabelle wieder vorbei. »Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt«, sagte sie, »oder dieser Rolf wieder vor der Tür steht, kannst du gerne bei mir anrufen.« Tamara lächelte und erinnerte sich, daß es ausgerechnet Rolf gewesen war, der ihr Isabelle bei einer Ausstellungseröffnung vorgestellt hatte. Isabelle war gleich am nächsten Tag vorbeigekommen und hatte ihr den Auftrag erteilt, das Haus Varnhagen in botanischen Fragen zu beraten, und damit stand fest, daß diese Geschäftsbeziehung kompliziert werden, daß es in dieser Beziehung nicht nur ums Geschäft gehen würde.
»Los, ausfüllen!«, sagte Isabelle und hielt ihr ein Formular vor die Nase. Tamara überflog das Papier. Es war der Aufnahmeantrag der Philosoph-Literarischen Gesellschaft.
»Und wenn ich mich weigere?«
»Dann fälsche ich deine Unterschrift.«
Tamara unterzeichnete und dachte: Das Kleingedruckte will ich gar nicht erst lesen. Zwei Tage später fand sie den gelb-roten Mitgliedsausweis der Philosophiegesellschaft in ihrem Briefkasten. Der Jahresbeitrag war bereits bezahlt. Sie legte den Ausweis in die Kasse zu dem noch immer ungeöffneten Brief vom Finanzamt. Nein, sie ließe sich nicht aushalten. Ganz bestimmt nicht. Sie mußte Isabelle zumindest den Mitgliedsbeitrag überweisen. Auch wenn sie in diese philosophische Gesellschaft nicht eintreten wollte. »Scheiße«, brüllte sie und schaute in den großen Spiegel, vor dem die roten Rosen standen. Sie sah über die Blüten hinweg, die noch nicht aufgegangen waren, und betrachtete ihre Stirnfalten, die ihr ebenso häßlich vorkamen wie Isabelles Tränensäcke. Das Finanzamt schien nicht nur das Mädchenauge zu bedrohen, sondern auch ihren Körper anzugreifen. Tamara holte den grauen Brief aus der Kasse, öffnete ihn, überflog die Zahlen und warf ihn in den Papierkorb. Der Fiskus forderte rund zwanzigtausend Euro. Sie dachte an die Honorare, die sie als Innenarchitektin bekommen und nicht versteuert hatte. Selbst in einem mittelmäßigen Jahr wären die Zwanzigtausend ein Klacks. Und nun? Sie war Ende dreißig, und der Spaß war vorbei. Warum zum Teufel hatte sie kein Geld zur Seite gelegt? Die Renovierung des Blumenladens hatte die allerletzten Reserven aufgebraucht. Scheiße. Aber hätte sie darauf verzichten sollen, ihren ersten eigenen Laden zu gestalten? Wenn nicht bald ein Wunder geschah, wäre dieser Traum schnell ausgeträumt.
Am Ende der ersten Märzwoche ließ sich der Lilienmann wieder blicken. Das war zwar noch nicht das erhoffte Wunder, aber zumindest eine gute Abwechslung. »Schön, daß Sie dieses Mal nicht gleich wieder weglaufen.« Tamara betrachtete seinen Leinenanzug und die rosa-weiß gestreifte Krawatte. »Ich hatte das Gefühl, daß ich störe«, sagte er. Seine helle Kleidung paßte gut zu seiner gebräunten Haut. Rolf war immer käseweiß. Oder krebsrot, wenn er in der Sonne blieb. Aber weshalb dachte sie überhaupt an diesen unansehnlichen Miesepeter? Der Lilienmann mußte gar nicht lächeln, um angenehm und freundlich zu wirken. Wenn der wüßte.
Natürlich bestellte der Lilienmann weiße Lilien, dieses Mal vergaß sie aber vor lauter Aufregung, ihm zumindest rote Lilien ans Herz zu legen. »Sie bieten mir ja gar keine Alternativen an«, sagte er prompt. Er lachte kurz. »Ja, wenn Sie ... ich dachte ... ähm, sie würden weiße Lilien bevorzugen«, stotterte Tamara und blickte auf seine schmalen, sauberen Hände. Unter ihren Nägeln klebte Blumenerde, und weil ihr das peinlich war, versuchte sie, ihre Finger zu verbergen, was natürlich nicht gelang, denn sie mußte die Blumen zuschneiden und in Papier einwickeln. Sie reichte ihm die Lilien und wunderte sich, wie langsam sich seine Arme und Hände bewegten. In aller Ruhe strich er sich durch seine blonden Haare, und als sie in seine grünlich-grauen Augen schaute, lächelte er wieder.
Der Lilienmann öffnete sein Portemonnaie. Tamara sah genau hin, konnte aber kein Foto einer Frau darin entdecken. In der Geldbörse steckte eine gelb-rote Karte. Der Mitgliedsausweis der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft! Sie kicherte und sagte dreimal hintereinander, wie schön der Frühling sei. Der Lilienmann nickte und begutachtete, wahrscheinlich aus Verlegenheit, die Traubenhyazinthen auf dem Kassentisch. Sie stellte sich vor, mit ihm über Kant und Hegel zu philosophieren, obwohl sie keine Zeile Kant oder Hegel gelesen hatte. Vermutlich war doch nicht jeder Philosoph ein ausgemachter Spinner. Aber wer sagte, daß der Mann sich bei Kant und Hegel überhaupt auskannte? In ihren Gedanken saßen sie und er in einer Pizzeria, und nach dem dritten Glas Rotwein gab der Lilienmann zu, daß er von Philosophie auch keine Ahnung habe.
Er trug keinen Ehering, was nichts bedeuten mußte. Sie würde bestimmt noch herausfinden, wem er die weißen Lilien schenkte. »Sie haben ja wirklich einen tollen Job«, sagte der Lilienmann, und als er davon sprach, daß es ihm auch gefiele, den ganzen Tag von Blumen umgeben zu sein, kam ihr wieder Rolf in den Sinn, der kein einziges Mal so etwas gesagt hatte. Der Lilienmann schien sogar etwas von Blumenzucht zu verstehen. Sie unterhielten sich über die Wachstumszyklen der Tulpen, und als der Lilienmann erzählte, welcher Magnolienbaum im Park aus welchem Land kam, spürte sie, wie sich ihre Neugier zu einem Wunsch entwickelte: Diesen Mann wollte sie endlich näher kennenlernen.
In den nächsten Tagen kreierte sie Blumensträuße, die auch die Varnhagen nicht kaufen mochte. Tamara band Tausendschönchen mit grünem Wildspargel und Eichblättern zusammen. Kombinierte Tulpen mit Pampasgras. Sie aß kaum, obwohl sie ständig Hunger hatte. Sie schlief schlecht ein, und wenn der Wecker am Morgen klingelte, hatte sie das Gefühl, seit Stunden wach im Bett zu liegen. Tagsüber war sie so müde, daß sie beim Autofahren manchmal einnickte, und so hätte sie den Lilienmann, als sie ihn zum ersten Mal außerhalb des Blumengeschäfts sah, beinahe nicht erkannt.
Sie saß in ihrem Lieferwagen und wartete vor einer rote Ampel. Nicht weit entfernt stand er auf einer Leiter, trug einen schmutzigen Blaumann und klebte Werbung auf eine Plakatwand. Er hatte schon die Hälfte des Plakats angebracht, zwei Pferdeköpfe waren bereits zu erkennen. Er drehte sich um, langsam, fast behäbig, und ihre Blicke trafen sich. Er hatte sich einige Tage nicht rasiert, und seine dichten und dunklen Bartstoppeln machten ihn noch attraktiver. Nur daß der Mann Reklame aufhängte, paßte nicht. Sie wäre gerne ausgestiegen, hätte sich mit ihm unterhalten. Aber worüber? Über Kant und Hegel? Sollte sie ihn vielleicht fragen, ob das Arbeitsamt keine besseren Jobs vermittelte?
Grün!
Hinter ihr wurde schon gehupt. Bevor sie weiterfuhr, winkte er ihr zu. Der Rest des Plakates entfaltete sich und wehte im Wind. Hinter dem Lilienmann ritt nun ein Cowboy durch die Prärie.